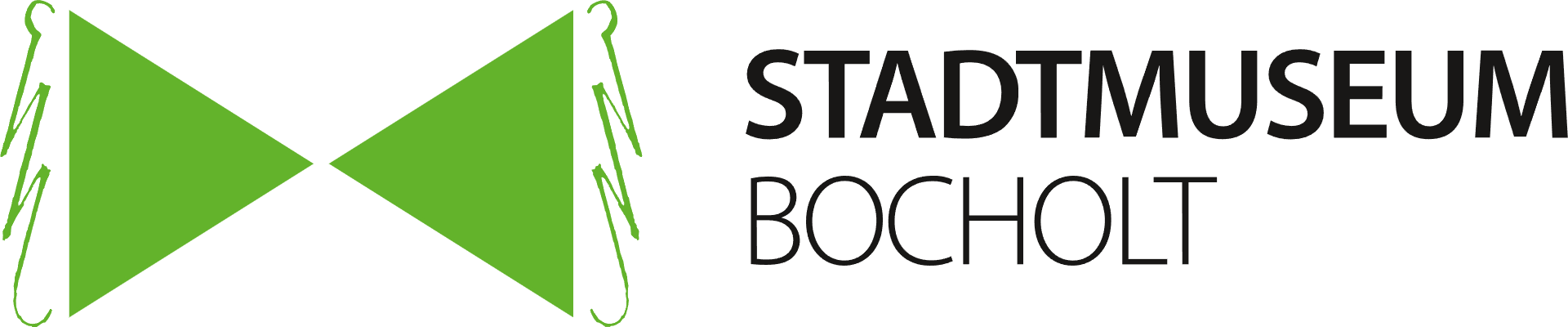Objekt des Monats – Juni2025
Einmal im Monat präsentiert das Stadtmuseum in Kooperation mit dem Bocholter-Borkener Volksblatt (BBV) ein Objekt aus seiner Sammlung.
Bartmannskrug
Datierung: 17. Jhd.
Maße: 178x109x109cm
Material: Ton, Steinzeug (Hochgebrannt, wasserdicht ohne Glasur)
Fundzeit: 1985/1986
Inv. Nr. 2023.310
Archäologische Gruppe Bocholt
Fotos: Stadtmuseum Bocholt
Bartmannskrug aus dem 17. Jahrhundert
Der im Stadtmuseum Bocholt verwahrte Bartmannskrug (Inv.-Nr. 2023.310) stammt aus archäologischen Grabungen am St. Georgsplatz 1, dem Gelände des heutigen Pfarrheims. Die Grabung, durchgeführt 1985/1986 durch die Archäologische Gruppe Bocholt, erfasste Teile eines ehemaligen Friedhofs mit Fundamentresten und einem Brunnen.
Der Krug datiert in das 17. Jahrhundert und misst 178×109×109 mm. Gefertigt wurde er aus hochgebranntem Steinzeug, einem keramischen Werkstoff, der durch seine dichte Struktur ohne zusätzliche Glasur wasserdicht ist. Das auffälligste Merkmal ist die aufgeprägte Maske eines bärtigen Mannes am Hals des Gefäßes – ein typisches Kennzeichen sogenannter Bartmannskrüge. Die Darstellung variiert je nach Werkstatt zwischen grimmiger Fratze und karikaturhaftem Gesicht.
Bartmannskrüge dienten in der Frühen Neuzeit vorrangig zur Aufbewahrung und zum Ausschank von Flüssigkeiten wie Bier oder Wein. Ihre Produktion war vor allem im Rheinland konzentriert, insbesondere in Köln und Frechen. Diese Orte verfügten über hochwertige, schamottreiche Tonvorkommen, die sich ideal für das Brennen von Steinzeug eigneten. Die Nähe zum Rhein begünstigte zudem den überregionalen Handel.
Die Krüge wurden im 16. und 17. Jahrhundert in großer Zahl europaweit exportiert – unter anderem nach England, Skandinavien, in die Niederlande und bis nach Nordamerika. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung und zeitlich klar eingrenzbaren Produktionsformen gelten Bartmannskrüge heute als wichtige Datierungshilfen in archäologischen Fundkontexten.
Der Bocholter Bartmannskrug stellt ein bedeutendes Beispiel für die materielle Alltagskultur der Frühen Neuzeit dar und bietet zugleich einen Einblick in überregionale Handelsbeziehungen, handwerkliche Produktion und symbolische Gestaltung des 17. Jahrhunderts.